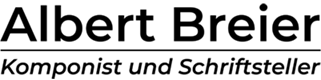Gespräche
Mathematik, Ethik und Zeit in der Musik
Czech Music Quarterly / 2010
Interview lesen:
Du hast dich in der letzten Zeit viel mit Mathematik beschäftigt – einige Leute sagen, daß Musik und Mathematik miteinander viel gemeinsam haben. Abgesehen vom physikalischen Aspekt des Tons und einigen strukturellen Mitteln sehe ich auch den Gebrauch von Formeln (vor allem in der traditionellen Musik) als etwas, das in beiden Bereichen ähnlich ist. Beeinflußt deiner Ansicht nach die Art des mathematischen Denkens den Zugang zur musikalischen Kreativität?
Albert Breier
Es ist wahrscheinlich richtig, daß es keine Musik gibt, die völlig frei von Mathematik wäre (und die Umkehrung scheint auch zu gelten – der berühmte französische Mathematiker Jean Dieudonné nannte die Mathematik „die Musik des Verstandes“). Und so müssen auch Komponisten, die sich in ihren Partituren nicht bewußt mit der Mathematik befassen, auf den Tag gefaßt sein, an dem irgendein Musikwissenschaftler höchst komplizierte mathematische Strukturen und Strategien in ihrer Musik entdeckt…
Das Problem mit Formeln ist – in Musik wie Mathematik – , daß sie dazu neigen, universale Gültigkeit und Anwendbarkeit für sich zu reklamieren. Das Barock, die Blütezeit mathematischer und musikalischer Formeln, entwickelte die Idee einer mathesis universalis, eines umfassenden, auf der Mathematik beruhenden Gedankensystems. (Leibniz, der größte Verfechter der mathesis universalis, wird heute hochgeschätzt als bedeutendster Ahnvater der Computerwissenschaft.) Obwohl vielleicht der große populäre Erfolg der Barockmusik zum Teil ihrer formelhaften Konstruktion zu verdanken ist, bezweifle ich, ob darauf wahre musikalische Kreativität gegründet werden kann. Für mich ist das Problem eher, in meiner Musik die Mathematik loszuwerden, was nicht sehr leicht ist. Mathematik taucht an den unerwartetsten Stellen auf, und ich muß gut aufpassen – manchmal ist es sogar notwendig, seinen Frieden mit dem Feind zu machen.
Um nicht ungerecht zu sein, muß ich hinzufügen, daß ich mich dem Intuitionismus, einer von dem Niederländer L. E. J. Brouwer begründeten mathematischen Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts, ziemlich nahe fühle. Wir verdanken Brouwer einige recht paradoxe Aussagen über die Mathematik, z. B. „Mathematik ist mehr ein Tun als eine Lehre“. Und Brouwer hat auch gesagt: „Alle Mathematik ist sündhaft“…
Peter Graham
Mathematik und Musik werden als höchst abstrakte Disziplinen betrachtet, jenseits von Gut und Böse. Beide werden aber für gute und böse Zwecke gebraucht oder mißbraucht. Sind wir schließlich nicht immer mit der Ethik konfrontiert, sogar wenn wir diese Frage zu vermeiden suchen?
Albert Breier
Der Mathematik, besonders der höheren Mathematik, ist es immer gelungen, eine Aura von äußerster Reinheit um sich zu schaffen. Einige Komponisten haben versucht, von dieser Aura zu profitieren; sie stellten sich vor, daß mathematische Reinheit automatisch musikalische Reinheit hervorbringt. Aber im ganzen scheint dies nicht der Fall zu sein. Noch mehr: mathematische Reinheit ist in keiner Weise mit ethischer Reinheit identisch. Gewiß war die Bombe, die Hiroshima zerstörte, ein Triumph der reinen Mathematik (einige sagen, sogar in größerem Maße als ein Triumph der modernen Physik). Die Beziehungen zwischen Mathematik und Ethik sind noch immer fast unerforscht. Aber unser tägliches Leben wird immer mehr von den Zahlen beeinflußt und gelenkt, und ich denke, daß es von zunehmender Bedeutung sein wird, den ethischen Implikationen dieser Tatsache Rechnung zu tragen.
Für mich sind reine Mathematik und reine Musik Mythen. Das bedeutet nicht, daß ich nicht das Streben nach Reinheit in der Musik respektiere (ich bin ein großer Bewunderer Weberns), aber mathematische Strenge der Struktur ist ganz entschieden nicht der einzige Weg, sie zu erreichen. (Schließlich sollte die mathematische Strenge von Weberns Partituren nicht zu sehr hervorgehoben werden, wie das die Darmstädter Schule tat – der lyrische Schwung ist wichtiger.)
Peter Graham
In der sogenannten europäischen Tradition (ungefähr vom 16. – 19. Jahrhundert) lag die größte Betonung wohl auf dem vertikalen Aspekt, dem Akkord (sogar in polyphoner Musik). Während des 20. Jahrhunderts können wird eine Verschiebung hin zum horizontalen Aspekt beobachten – hin zur Zeit. Was ist deine Sicht dieses Prozesses?
Albert Breier
Das Mittelalter schuf Häuser für Gott; im 16. – 19. Jahrhundert wurden Häuser für Menschen gebaut. Die Architektur ist jetzt schon seit über einem Jahrhundert im Stadium des völligen Verfalls; die Leute ziehen immerzu umher, und so kann auch die Musik keine tragfähigen vertikalen Strukturen mehr hervorbringen.
Mit den Leuten zieht auch die Musik umher: sie hat den großen Vorteil, daß man sie mitnehmen kann. Es ist möglich, beim Gehen zu singen, sogar ein Instrument zu spielen …
Das wachsende Bewußtsein der Zeit eröffnet neue Möglichkeiten für die Musik: schließlich beschäftigt sich die Musik in erster Linie mit der Zeit, und es ist sehr seltsam, daß diese grundlegende Tatsache so lange ignoriert worden zu sein scheint (wenigstens von den Theoretikern).
Peter Graham
Kannst du etwas über deinen persönlichen Zugang zur Zeit sagen?
Albert Breier
Manchmal träume ich von einem paradiesischen Zustand, in dem sich Musik und Zeit nicht mehr unterscheiden, sondern vollkommen miteinander verschmelzen… Ich weiß, daß das mit menschlichen Mitteln nicht erreicht werden kann; die Musik als Kunstform bleibt immer bis zu einem gewissen Grade zeitfremd. Aber wir können verhindern, daß sie zum Feind der Zeit wird. Vielleicht sind einige der heute am höchsten geschätzten europäischen Meisterwerke der Musik in Wirklichkeit der Zeit gegenüber feindlich eingestellt.
Mit der Zeit umzugehen ist eine gefährliche Sache; ganz entschieden hat die Zeit ihre Schrecken. Aber vielleicht kann die Musik eine Art Freundschaft mit der Zeit erreichen, vielleicht kann sie den Fluß der Zeit hörbar machen, der nie eintönig ist.
Peter Graham
Die europäische Musik hat sich in relativer Isolation von den anderen musikalischen Kulturen entwickelt. Gibt es in der Musik universale Prinzipien? Ich weiß, daß du sehr interessante Parallelen zwischen der europäischen Symphonik und der chinesischen Malerei siehst …
Albert Breier
Es ist möglich, daß sich „musikalisches Denken“ nicht notwendigerweise nur in den musikalischen Hervorbringungen einer Kultur manifestiert. Es kann in der Malerei oder der Dichtung stärker hervortreten (oder, um zu diesem Thema zurückzukehren, in der Mathematik…). Zum Beispiel besitzt die Dichtung Verlaines eine größere musikalische Kraft als etwa die Musik von Charles Gounod.
Ich stand immer unter dem Eindruck, daß die großen chinesischen Maler eine viel größere musikalische Begabung hatten als die chinesischen Musiker. (Natürlich möchte ich die großartigen Leistungen der chinesischen qin-Musik nicht verkleinern.) In ihren langen Querrollen zeigen sie ein Gefühl für Zeitproportionen, das man wahrhaft symphonisch nennen darf (schon vor einem Jahrhundert hat der Sinologe Berthold Laufer das halbmythische chinesische Malergenie Wang Wei mit Beethoven verglichen).
Ich denke, daß es schwierig ist, von allgemein gültigen musikalischen Prinzipien zu sprechen. Aber der ganzen Menschheit ist vielleicht ein musikalischer Geist eigen, der sich jedoch frei in vielen möglichen Weisen aussprechen kann.
Peter Graham
Gibt es für dich als Komponist eine entscheidende Frage?
Albert Breier
Obwohl ich dich nicht mit einer ausführlichen Klage über meine persönlichen Schwierigkeiten mit dem Komponistenleben langweilen will, würde ich doch gerne sagen (wie es zweifellos schon oft gesagt worden ist …), daß die Rolle des Komponisten in der Gesellschaft heute höchst unklar ist. In gewisser Hinsicht kann man nur von den toten Komponisten sagen, daß sie „existieren“. Lebende Komponisten sind in bezug auf die Frage, was sie „sind“ oder „sein sollen“, sehr unsicher; bis hin zu dem Punkt, daß sie nicht wissen, ob sich sich selbst überhaupt „Komponisten“ nennen oder einen anderen Namen gebrauchen sollten …
Wird es in der Zukunft eine Institution geben, der der Komponist dienen kann, ohne seine Integrität zu opfern? Soweit ich sehe gibt es heute keine. Ich kann den Tag nicht voraussagen, an dem die Einsamkeit – diese moderne Krankheit – die Komponisten endlich verlassen wird. Aber meiner Meinung nach arbeite ich nie für mich allein.
Ohne Freundschaft könnte ich nicht überleben. Aber die Freunde sind wenige und über die Welt verstreut. Dennoch werde ich die Hoffnung nicht aufgeben.
Schweben und Strenge
A tempo Revue / 2009
Interview lesen:
Sie haben öfter gesagt, daß für Sie der entscheidende Einfluß die Musik von Morton Feldman war. Können Sie etwas dazu sagen? Sind Sie bei der Wahl Ihres Vorbilds nur Ihrem Gefühl gefolgt oder haben Sie dafür auch rationale Begründungen?
Albert Breier
Die Musik von Morton Feldman war für mich aus mehreren Gründen wichtig. Zunächst wegen ihrer großen Ruhe und Konzentration. Aber auch, weil sie nicht nach einem System konstruiert ist, aber dennoch den Eindruck großer Strenge macht. Feldmans Musik kennt das Geheimnis, vollkommen „logisch“ zu wirken, ohne daß man weiß, wie sie „gemacht“ ist. Es ergibt sich daraus ein schwebender Charakter, den ich sehr liebe.
Ondrej Štochl
Jetzt zu Ihrer Musik. Die hat auch einen schwebenden Charakter, mir ist ihre Leere und Unbestimmtheit sehr angenehm. Meiner Meinung nach spielt bei Feldman und auch bei Ihnen die Arbeit mit der Strukturierung der psychologischen Zeit eine große Rolle. Haben Sie dafür rationale Regeln oder Prinzipien?
Albert Breier
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht, daß man die Psychologie rational erfassen kann. Ich stelle mir außerdem vor, daß die Erfahrung der Zeit etwas ist, was über die Psychologie hinausgeht. Beim Komponieren habe ich nicht so sehr ein positives Prinzip; ich versuche eher, alles zu vermeiden, was der Zeiterfahrung im Wege stehen könnte.
Ondrej Štochl
Also ist Ihre Arbeit rein intuitiv?
Albert Breier
Meine Arbeit ist nicht nur intuitiv. Aber es gibt ein intuitives Element darin, das ist ganz einfach die Bestimmung der Länge: wie lang soll ein Ton dauern, wie lang ein Abschnitt, wie lang das ganze Stück. Wenn ich das weiß, besteht die restliche Arbeit darin, jede Art von Verfestigung zu vermeiden, die den Eindruck des Schwebenden vernichten könnten. Dafür habe ich ziemlich strenge „Regeln“: zum Beispiel sollen einfache mathematische Verhältnisse vermieden werden, sowohl in der zeitlichen Proportion als auch in der Intervallstruktur. Das heißt, es gibt keine Abschnitte, deren Länge im Verhältnis 2 : 1 steht usw. Bei den Intervallen gehe ich sehr vorsichtig mit Oktaven und Quinten um, weil sie die „stärksten“, „festesten“ Intervalle sind. Sie sollen nicht ganz ausgeschlossen bleiben, aber wenn sie auftauchen, müssen sie durch „Gegenkräfte“ neutralisiert werden, eine Quinte etwa durch eine Sexte. Allgemein bevorzuge ich die Intervalle, bei denen der Grundton nicht der Baßton ist: Quarte, Sexte, Sekunde. Das Verhältnis von Konsonanzen und Dissonanzen muß ausgewogen sein, zu viele Dissonanzen machen leicht den Eindruck des Starren, Unbewegten. Wenn ich arbeite, gilt für mich: „Der erste Ton ist frei, die anderen sind gebunden.“ Selbst wenn ich mir intuitiv über die Zeitverhältnisse des Stücks klar bin, muß jeder neue Ton „erarbeitet“, „erdacht“ werden, wird also nicht mehr rein intuitiv gefunden.
Ondrej ŠtochlAus Ihrer Antwort schließe ich, daß der schwebende Charakter Ihrer und anderer Musik auf dem Prinzip der Neutralisation in der Mikrostruktur beruht. Das stimmt mit meinem gefühlsmäßigen Eindruck überein. Dank diesem Prinzip wird für mich diese (und auch Ihre) Musik zu einem fast mystischen Erlebnis – zu etwas der Zeitfolge Enthobenem (Eliade hat darüber geschrieben). Können Sie sagen, wie Sie zu Ihren strengen Regeln gekommen sind?
Albert BreierFür die Strenge meiner Arbeitsweise gibt es, soweit ich das selbst beurteilen kann, zwei Ursachen: erstens die Erfahrung, daß mir eine ungeheuer große Menge von musikalischem Material zur Verfügung steht, Musik als vielen verschiedenen Ländern und Zeiten, daß es aber keine Möglichkeit gibt, zu bestimmen, welche Musik die „richtige“ Musik ist. Zweitens, (damit zusammenhängend), daß es eigentlich in einem bestimmten Sinn überhaupt nicht mehr möglich ist, „direkt“ oder „spontan“ zu komponieren. Das heißt, ich muß in der Musik alles zulassen (alles darf vorkommen), aber nichts darf zu sehr an eine bestimmte Tradition, einen bestimmten Stil erinnern. Ich habe sehr viele Möglichkeiten und zugleich keine Möglichkeiten. Ich muß Musik schreiben und darf gleichzeitig keine Musik schreiben. Mein Ausweg aus dieser verzweifelt schwierigen Situation ist, daß ich versuche, eine bestimmte Art von musikalischer Offenheit zu erreichen. Offenheit heißt nicht, daß die Musik unverbindlich und beliebig wird; ich glaube, daß man gerade, um den Eindruck der Offenheit zu erreichen, sehr streng arbeiten muß. Die Gefahr ist eben sehr groß, daß man doch immer wieder ein Klischee produziert. Ein Klischee ist für mich auch eine bestimmte Art von „Avantgarde“Musik, die nichts als „neu“ sein will und deshalb in der Regel sofort langweilig wird.
Ondrej Štochl
Das ist sehr interessant. Können Sie sagen, welche Art von Avantgarde-Musik für Sie nurmehr ein langweiliges Klischee darstellt?
Albert Breier
Ich glaube, daß jede Musik schnell zum Klischee werden kann, die nur „neu“ oder nur „sie selbst“ sein will. (Man braucht gar nicht unbedingt an die Avantgarde des 20. und 21. Jahrhunderts zu denken, schon Wagner ist für mich ein Beispiel.) Das heißt, ohne eine lebendige Auseinandersetzung mit der Geschichte kann eine Musik nicht auf Dauer interessant sein. Natürlich ist auch die bloße Nachahmung von historischen Stilen langweilig, aber ich glaube, daß es nicht gut ist, die Geschichte ganz aus dem Blick zu verlieren.
Ondrej Štochl
Gehen bei Ihnen die Regeln der Komposition voraus oder abstrahieren Sie sie aus Ihren intuitiv gewonnenen Ergebnissen? Sollten nach Ihrer Meinung die Regeln einer Komposition zugrundegelegt werden oder sollten sie sich allmählich aus dem Arbeitsprozeß entwickeln?
Albert Breier
Ich denke, man kann nicht grundsätzlich sagen, ob die Regeln zuerst kommen oder die Erfindung. Vielleicht sollte man gar nicht von „Regeln“, sondern ganz allgemein von „Handwerk“ sprechen? („Regeln“ klingt mir zu abstrakt.) Ein guter Handwerker hat natürlich gewisse Kenntnisse, bevor er zu arbeiten beginnt, aber er muß sich doch auch auf die Probleme einstellen, die erst während der Arbeit sichtbar werden. Es gibt eben immer vieles, was man zu Anfang noch nicht wissen kann und bei dem einem keine Regeln helfen.
Ondrej Štochl
Kommen wir zurück zu Ihrem Verhältnis zu Feldman. Wenn ich seine Musik höre, kann ich gar keine Kontraste finden – oder vielmehr, alle Kontraste bleiben bloß innerhalb der Mikrostruktur. Das resultierende Spannungsniveau ist deshalb so konstant, daß man eigentlich keinen Kontrast und keine Spannung mehr fühlen kann. Bei Ihrer Musik sind für mich gerade die Kontraste – scharfe, energiegeladene – sehr interessant, wobei Sie diese Kontraste nicht im Sinn der klassischen Form oder Architektur einsetzen. Die Kontraste existieren allein in der Zeit, ohne einen Formzusammenhang zu begründen – und die Musik ist einfallsreich, mit großen Umschwüngen, bleibt aber trotzdem im Ausdruck ganz statisch. Können Sie sagen, wie Sie das erreichen?
Albert Breier
Ich glaube, Feldman wollte so etwas wie eine „reine“ Zeiterfahrung, deswegen hat er weitgehend auf Kontraste verzichtet. Für mich ist die Zeit dagegen „unrein“, das heißt, grundsätzlich kann alles vorkommen, auch schärfste Kontraste sind möglich. Wichtig ist nur, daß man die Kontraste nicht als „Architektur“ hört, sondern als Zeitereignisse. Die Kontraste geschehen einfach, wie die Ereignisse in der Welt geschehen. Es entsteht dadurch kein Gebäude, das man wie ein Haus „schön“ oder „nicht schön“ finden kann aufgrund seiner Proportionen, Verzierungen usw. Deswegen gibt es auch keinen Wechsel des Ausdrucks. Der Rhythmus der Ereignisse ist etwas, das man aufmerksam und konzentriert betrachten soll, man soll sich nicht durch starke Emotionen mitreißen lassen.
Ondrej Štochl
In der letzte Zeit nehme mir bei der Beschäftigung mit Ihrer Musik immer stärker ihre Verwandtschaft mit der chinesischen Malerei wahr. Können Sie dazu etwas sagen?
Albert Breier
In der chinesischen Malerei gibt es eine sehr interessante und sehr perfekte Gestaltung der Zeit. Das ist merkwürdig, weil die Malerei ja als eine räumliche Kunst gilt. Ich glaube, daß die europäische Musik der Gestaltung der Zeit bisher aus dem Weg gegangen ist, sie hat sich viel mehr um räumliche Form, Architektur usw. gekümmert. Für mich bedeutet die chinesische Malerei ein großes Vorbild, weil sie einerseits sehr strenge, allgemein gültige Regeln hat, andererseits sich immer direkt auf Körper und Geist (und Seele) des einzelnen Künstlers bezieht. Auch wenn die chinesische Malerei sehr abstrakt ist, erkennt man doch immer, daß sie von der Hand des Künstlers stammt (anders als z. B. eine Fotografie). Ebenso denke ich, daß auch die sehr abstrakte Musik von der Stimme (dem Atem) des Komponisten herkommen soll. Darin liegt gleichzeitig eine Gebundenheit wie eine Freiheit.
Ondrej Štochl
Lassen Sie uns zum Schluß noch einmal auf den „schwebendem Charakter“ ihrer Musik zurückkommen. Viele Komponisten spüren heute die Notwendigkeit, Musik mit statischem Ausdruck schreiben – einige nur zur Benützung bei „Meditationen“ (oder wie man es nennen soll), aber manche wollen auch wirklich ernste und tiefe Musik hervorbringen. Warum ist Ihrer Meinung nach eine solche Musik heute im europäischen Kulturraum so wichtig?
Albert Breier
Vielleicht ist es so, daß die Menschen in Europa heute nicht mehr so „in Musik leben“ wie in früheren Zeiten. Es werden bestimmte Werke immer wieder gespielt, aber diese „Kultur“ hat mit dem Leben der Menschen nicht mehr sehr viel zu tun. Es herrscht überall eine gewisse Erstarrung. Die „schwebende Musik“ ist vielleicht eine Art, wie man heute „in Musik leben“ kann. Das heißt, sie versucht keine „Meisterwerke“ hervorzubringen (die sind immer auch etwas Unbewegtes), sondern es geht um die Möglichkeit, in der Musik „ein paar Schritte zu gehen“ („einen Weg zu finden“, wie die chinesischen taoistischen Maler).
im Gespräch mit Nikolaus Brass
Zu Breiers kompositorischem Denken
Bayerische Akademie der Schönen Künste / 2023
Interview lesen:
- Januar 2023, Bayerische Akademie der Schönen Künste
Gespräch mit Nikolaus Brass
im Rahmen eines Portraitkonzerts mit vier Kammermusikwerken von Albert Breier
Colours of Memories für Flöte solo
Chant d’en haut für Flöte, Klarinette und Violine
Himmelsstufen für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello und Glockenspielt/Crotales
sowie nach dem Gespräch:
Streichquartett Nr. 6 (UA, Auftragswerk der BAdSK)
NB
In welche Höhe hast Du uns geführt, was für eine Höhe ist das?
AB
Ich bin mehr ein Mensch des Mittelgebirges, würde ich sagen. Was ich vor allem schön finde bei Mittelgebirgen ist, daß die Aussicht wunderbar ist, eigentlich sogar besser als bei manchen Hochgebirgsgipfeln, wo dann andere noch höhere Gipfel sein können, die einem die Aussicht verstellen, während ein schönes Mittelgebirge, sagen wir mal so zwischen 800 und 1200 Metern, die Gegend wäre, in der ich mich gern befinden würde.
NB
Aber gibt es im Mittelgebirge „Himmelsstufen“?
AB
Ja, die gibt es schon. Manchmal tritt ja dieser Effekt ein, wenn es ein bißchen neblig ist oder wolkig, daß man gar nicht genau weiß, wo die Berge aufhören und wo der Himmel anfängt. Das ist ein sehr schöner Effekt. Und diese Stufen sind natürlich immer halb imaginär, obwohl sie sich auf biblische Vorbilder berufen können – die Jakobsleiter –, und natürlich gibt es auch wirkliche Berge mit Stufen, die in den Himmel führen. In China haben die buddhistischen Klöster Anlagen, wo dann wirklich eine riesige Treppe vom Fuß des Berges bis in den Himmel zu führen scheint. Es ist aber eigentlich eine ganze Wissenschaft für sich, man kennt das vielleicht in Europa am besten aus Dante, aus dem Paradiso der Göttlichen Komödie, wo das Paradies sehr architektonisch gedacht ist, mit verschiedenen Kreisen, verschiedenen Stufen, die einen immer höher führen.
NB
Ist es falsch, wenn ich jetzt gerade bei den letzten beiden Stücken, eigentlich bei allen dreien, etwas Räumliches, Landschaftliches spüre? Das hat sich bei mir eingestellt, durch den Höreindruck. Spielen diese Assoziationen für Dich beim Komponieren eine Rolle – ein Blick, eine Weite, eine Leere, oder ist das jetzt nur das Akzessorische und nicht das Eigentliche?
AB
Was das Eigentliche ist, ist natürlich für den Komponisten selbst nicht richtig zu beantworten, das überlasse ich gerne anderen. Aber es stimmt schon, daß das Landschaftliche eine Rolle spielt, und zwar vielleicht im Unterschied zu dem Architektonischen bei der klassischen Musik, die sich sehr stark an Architekturformen orientiert, an Symmetrien, während das Schöne an Landschaft ist, daß sie zwar geologischen Gesetzen folgt, aber für den Blick doch eher unvorhersehbar ist. Man weiß nicht genau, wieso die Berge so aussehen, wie sie aussehen und wie sich diese Gebirgslinien gestalten, obwohl es dafür sicher einen Grund gibt. Aber das Auge, wenigstens mein Auge, erfreut sich an diesem Widerspiel von Symmetrie und Asymmetrie, Sobald man denkt, man hat jetzt einen Berg oder eine Formation, die wirklich symmetrisch ist, dann kommt da irgendetwas anderes, was diese Symmetrie wieder aufbricht. Und das ist für meine Musik glaube ich schon von großer Bedeutung, daß man das Gefühl hat, aha, ich folge jetzt hier einem Gesetz, aber was dieses Gesetz genau ist, das entzieht sich auch deswegen, weil es ständig in Wandlung begriffen ist, und dasselbe erfreut mich eben auch an Landschaften, an Gebirgszügen.
NB
Ich möchte beim Landschaftsaspekt bleiben. Der Titel Deines Buches „Die Zeit des Sehens und der Raum des Hörens“ – kannst Du dazu etwas sagen, es ist ja ein bißchen paradox.
AB
Ja, weil man eben normalerweise Sehen und Raum in Zusammenhang bringt und Hören und Zeit. Die Musik hat sich ja nur soweit zur Kunstmusik entwickeln können, wie sie auch viele räumliche Elemente in sich einbezogen hat. Das fängt schon bei der Partitur an – als Komponist hat man keine andere Möglichkeit, mit den Musikern zu kommunizieren, als eben eine Partitur zu schreiben, die dann realisiert wird. Diese Partitur ist aber durchaus etwas Räumliches: Wenn man da draufschaut, gibt es die Notenlinien, es gibt die Takte, es ist kein Gebilde, das nur eine zeitliche Existenz hat. Ich würde sogar denken, daß die reine Zeit eigentlich auch eher eine Utopie ist, eine Illusion. Mich hat es immer ein bißchen geärgert, daß man von der Musik als reiner Zeitkunst sprach, weil ich finde, daß das nicht stimmt. Auch das Thema der Erinnerung hängt damit zusammen, weil Erinnerung auch nur Sinn hat in einer räumlichen Welt. In einer rein zeitlichen Welt, wo man dem Zeitfluß folgen würde, würde man immer sofort immer wieder alles vergessen, weil man keine Möglichkeit hat, in diesen Zeitstrom irgendwelche Pfähle einzuschlagen. Aber sobald man das tut, und die Musik, die macht es ja auch, sie arbeitet ja auch mit Erinnerungen, hat man sofort wieder ein räumliches Gebilde.
Mich hat das so stark interessiert, weil die chinesische Malerei das gerade umgekehrt macht. Sie geht aus vom Räumlichen, natürlich, von Landschaftsformen, aber so wie die Bilder gemalt sind, in solchen potentiell endlosen Rollen, also Bildrollen, die man gar nicht mit einem Blick erfassen kann, sondern die man immer weiter ausrollt, und immer wieder kommt ein neuer Berg, das hat natürlich auch etwas Zeitliches an sich, weil es eben ein Prozeß ist. Da wird das Räumliche dann manchmal fast aufgehoben, dadurch daß man diesen Landschaften in der Zeit folgt.
Ich fand diese Komplementarität von europäischer Musik, die architektonisch und räumlich ist, und chinesischer Malerei, die vom Raum ausgeht, aber dann auch zeitlich wirkt, sehr faszinierend. Nur deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
NB
Mir war das nicht so klar – wenn Du von einer chinesischen Bildrolle sprichst, und Du hast es uns einmal zuhause demonstriert, sieht man immer nur einen Ausschnitt, man muß genau hinsehen, und dann verschwindet er, und der nächste erscheint. So kommt die Zeit ins Spiel, um allmählich das ganze Bild zu sehen. Das Bild ist nie ganz da – das ist eigentlich etwas Musikalisches, so wie ja das ganze Stück nie ganz da ist, sondern nur, wenn es verklungen ist, also wenn man es durchgehört hat. Hier auf dem Laptop sieht man ja, wie die Bilder springen. Das ist ja eine verblüffende Analogie zu dem Musiktext, das Stück wird praktisch abgetastet durch die Spieler, oder durch den Leser, wenn man die Partitur liest, und es stellt sich aber trotzdem eine Bewußtheit des Ganzen ein.
AB
Ich hätte es gerne, wenn man eine Partitur erfinden würde für meine Stücke, die genau wie eine chinesische Rolle gestaltet wäre, die praktisch endlos ist, sodaß die Takte immer weiter gehen und man auch nicht springen muß von einer Seite zur anderen. Ja, vielleicht ist das gar nicht mal so unmöglich. Und zu den chinesischen Rollen muß man sagen, daß es auch wirklich genau wie in der Musik ist, daß sie nur in einer Richtung funktionieren, also in China geht das von rechts nach links. Das heißt, wenn man die ausrollt, dann muß man wirklich immer rechts anfangen und sich vorarbeiten nach links. Das ist natürlich eine weitere Analogie zu einem Musikstück, wo man auch nicht einfach zurückspringen kann, sondern wo man darauf angewiesen ist, das, was erklungen ist, sich auch zu merken, damit man es dann irgendwann, wenn es wiederholt wird, auch wiedererkennen kann. Und das fand ich faszinierend, weil man bei uns Malerei nicht so sieht. Wenn man ein Bild vor sich hat, dann denkt man, es ist eigentlich egal, wo ich da anfange oder wo ich aufhöre, das kann ich auch ändern und wechseln. In China ist das ein Prozeß, dem man folgen muß und der Maler nimmt auch Rücksicht darauf, daß die Gestaltung wirklich nur in dieser Weise sinnvoll ist, und wenn man es dann rückwärts liest oder versucht, es rückwärts zu lesen, dann merkt man, das funktioniert nicht.
NB
Nochmal zu Deiner Musik, zu dem … harmonischen Gewächs. Ich finde, Deine Harmonik ist ja ungeheuer organisch sich entfaltend – kannst dazu etwas sagen, wo Deine Quellen sind, Deine historischen Bezugspunkte. Es ist ja keine reine Tonalität oder herkömmliche Tonalität, aber es ist tonal gedacht in jedem Takt, würde ich sagen. Worauf fußt Du da?
AB
Wir haben das Glück, oder je nachdem auch das Unglück, daß wir so eine unglaublich reiche harmonische Tradition haben, daß es ganze Zeitalter gab, die sich hauptsächlich mit Harmonie beschäftigt haben. Im 19. Jahrhundert hat das zu einer gewissen Übersättigung geführt, sodaß man Systeme von komplexen Harmonien hatte, bei Reger und noch später, wo man dann fast hilflos dasteht, weil man einfach nicht mehr folgen kann.
Was ich mir vorstelle, ist ein harmonischer Reichtum, aber in der Weise, daß die Harmonien sich immer erst allmählich entwickeln, nicht von vornherein gesetzt sind und nach Gesetzen kombiniert werden, daß so eine Harmonie sich immer erstmal finden will. Da ist der Ausgangspunkt natürlich oft ein einfacher Dreiklang oder auch überhaupt nur zwei Töne, es ist dann relativ egal, ob es Konsonanzen oder Dissonanzen ist. Wichtig ist das Gefühl, daß sozusagen die Harmonie sich findet, lebt und atmet und dann aber auch wieder verschwindet, um einer anderen Platz zu machen.
NB
Da haben wir ja eine bestimmte Epoche in der Musikentwicklung hier bei uns durchmessen, in denen das Punktuelle, das Lineare im Vordergrund stand und die harmonische Folgerichtigkeit oder harmonische Wachstumskraft einer Musik vielleicht nicht so. Wie blickst Du eigentlich zurück auf diese Zeit? Nehmen wir mal wieder unseren Großvater, mittlerweile Urgroßvater Schönberg, und den Versuch, aus der qualitativen Bezogenheit der Töne auszubrechen und zu sagen: mein Tonvorrat, der ist neutral, da gibt es keine präferierten Beziehungen, sondern cis und ges gehören dazu, egal, woher ich sie denke.
AB
Für mich ist das eine etwas zu statische Sichtweise, diese Neutralität, oder daß man in einem Tonsystem denkt, wo wirklich alle Töne gleichberechtigt sind und eben auch in gleicher Anzahl, zumindest theoretisch, vorkommen. Ich bin eigentlich eher für solche Balancebewegungen, sodaß es schon mal auch ein starkes Übergewicht gibt von einzelnen Tönen. Es ist ja auch so, daß manchmal wirklich nur ein einziger Ton dann von mehreren Instrumenten gespielt wird, was ich auch noch irgendwie unter Harmonik verbuche, weil es wichtig ist, daß da ein ständiger Wellenschlag stattfindet, wie sich die Harmonien bilden und verschwinden, und das bedeutet natürlich, daß einzelne Töne da auch mal im Vordergrund stehen können, anders als bei Schönberg. Aber trotzdem würde ich sagen, insgesamt ist es dann auch nicht so, daß mein Stück einem bestimmten Ton dann wirklich absoluten Vorrang einräumt. Eher ist es ein bißchen so wie in der chinesischen Malerei, da gibt es dann zwar auch bestimmte Höhepunkte, besonders hohe Berge, aber wichtiger ist dieser sanfte Wellenschlag, wie es auf und ab geht.
NB
Wellenschlag nennst Du es, für mich sind es unendlich langgezogene Linien, die Du entstehen läßt, ein Liniengeflecht, wobei die Linien nicht so als Gegensubjekte zu anderen Linien auftreten, sondern es so ist, als ob die Linien sich alle um eine unsichtbare Linie zentrieren. Du hattest im Vorgespräch gesagt, daß eine wichtige Begegnung für Dein Komponieren beispielsweise die Polyphonie der Niederländer des 15. Jahrhunderts ist, auch deren Anfänge, nicht die hochvirtuose, sondern die eher reduzierte eines Jacob Obrecht beispielsweise, kannst Du dazu noch etwas sagen?
AB
Diese Musik hat mich lange beschäftigt, nur war das Grundgesetz dieser Musik natürlich insofern anders, als sie ja vom Kontrapunkt ausging. Das heißt, wenn man eine Melodielinie schrieb, dann war sie immer schon so auch erfunden, daß sie einen Kontrapunkt zu einer anderen Linie bildet. Die richtig genialen Komponisten haben es dann aber allerdings dann geschafft, diese Tatsache vergessen zu machen. Man achtet dann nicht mehr darauf, ob die kontrapunktischen Gesetze erfüllt werden, sondern lauscht einfach dieser Melodie, wie sie unendlich immer weiter geht, und das war dasjenige, was mich begeistert hat. Ich mag auch den Kontrapunkt sehr gerne, aber das ist, glaube ich, eine vergangene Epoche, die man nicht wiederherstellen kann, während diese Idee, daß es eine Melodie gibt, die immer weiter geht und eigentlich auch nie sich richtig wiederholt, auch nicht langweilig wird, auch mit diesem Rhythmus von Spannung und Entspannung arbeitet, das ist ja etwas ganz Anderes, als man es in der klassischen Musik oder in der Volksmusik kennt, wo die Melodien sehr oft abschnittsweise symmetrisch gestaltet sind, daß es dann vier Takte sind, die entweder völlig identisch wiederholt werden oder mit einer etwas anderen Kadenz. Dem wollte ich entgehen, ich wollte dieser Strukturierung in gleichmäßige Abschnitte nicht mehr mitmachen, sondern eben diese unendliche Melodie erfinden. Die wird natürlich trotzdem immer auch harmonisch gestützt, aber sie ist dann in gewisser Weise auch, selbst wenn es mehrere Stimmen sind, die einzige Melodie. Es ist manchmal so, daß ich denke, wenn ich ein Solo schreibe, oder ein Trio oder ein Sextett, ist es im Prinzip immer nur eine Melodie, aber hat man die eben einmal in Soloausführung, einmal dreifach aufgefächert, oder sogar sechsfach aufgefächert, aber die Grundmelodie, das hast Du eben sehr schön gesagt, die ist immer da, bleibt auch immer.
NB
Jetzt wieder mein Eindruck von den drei gehörten Stücken, daß die eigentlich kein Ende haben, gehört das dazu?
AB
Das ist ein bißchen schwierig. Es haben sich ja im Laufe der Musikgeschichte bestimmte Formeln herausgebildet, an denen man erkennt, ob ein Stück aufhört, Bei Beethoven weiß man, wenn da acht laute Schläge im Fortissimo kommen, auch noch in der Grundtonart des Stückes, dann ist das Stück zuende,
Das 20. Jahrhundert liebte sehr diese allmählich verstummenden Stücke, man war es leid, daß es immer mit großem Krach aufhörte. Das gibt es schon bei Tschaikowski oder Mahler, wirklich große Werke, die verebben, ins Nichts gehen. Das war für mich beides nicht mehr richtig zu gebrauchen, weil einfach schon zu oft dagewesen. Ich versuche da immer so ein bißchen die Quadratur des Kreises, ich denke schon so rein psychologisch merkt man, meine Stücke werden gegen Ende ruhiger, der Klang wird ein bißchen reduziert, aber wann es dann genau aufhört, das bleibt trotzdem in der Schwebe. Ich weiß nicht, ob es unendlich weitergehen würde, das hat auch etwas mit klanglichen Gründen zu tun, z. B. das Stück für Flöte, Klarinette und Geige, wenn man das auf 70 Minuten erweitern würde, das wäre nicht so eine gute Idee.
NB
Noch ein paar Worte zum Streichquartett Nr. 6, der Auftragskomposition der Akademie. Als wir vor langer Zeit darüber sprachen, da hast Du gesagt: fein, dann mache ich noch ein Streichquartett.
AB
Ich bin in dieser Hinsicht dann doch ein bißchen auch traditionell, mit den sechs Streichquartetten, damit bin ich ja nicht alleine, die gibt es z. B. auch von Bartók. Ich hatte schon ziemlich früh eine Serie von sechs Klavierstücken geschrieben, die auch einfach Klavierstück I, II, III… heißen, und wollte nun jetzt ein Pendant dazu machen mit Streichquartetten, und die Idee war, daß sie ganz verschiedene Bereiche von dem, was ich mache, abdecken. Das heißt, jedes Streichquartett sollte sehr anders sein als das vorhergehende.
Mein erstes Streichquartett ist schon von 1982, da hatte ich diese Idee noch nicht, aber dann dachte ich irgendwann, das ist doch sehr reizvoll, diese Gattung ist dermaßen anspruchsvoll und belastet, da kann man jetzt nicht einfach irgendwas schreiben, sondern man sollte schon auch einen Plan haben, vielleicht sogar einen großen Plan für mehrere Stücke. Irgendwann tauchte die Idee auf, ich mache sechs Streichquartette. Schon im Barock schrieben die Komponisten ja gerne Werke im Sechserpack, Vivaldi, oder Bachs Brandenburgische Konzerte, ich fand diese Zahl dann auch reizvoll. Jetzt bin ich beim sechsten angekommen, damit soll erstmal Schluß sein. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dann doch Ideen bekomme für ein siebtes, keine Ahnung …
NB
Das ist jetzt eine blöde Frage: Wie verhält sich die Tradition zu dir, jetzt frage ich mal so herum.
AB
Das ist sehr nett, daß Du das so sagst…
NB
Ja, die kann ja auch brutal sein, sie kann einen ja auch ersticken, erschlagen, das Kreuz brechen, weiß Gott was alles …
AB
Ich denke, es ist so wie immer: Wenn man liebt, wird man ja auch zurückgeliebt, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer. (Es gibt auch einseitige Liebe, das ist klar.) Ich bin so großgeworden, daß man die Tradition nur mit scheelem Blick ansah, das ist noch ein bißchen die Nachkriegsstimmung, Stunde Null, da wollte man wieder ganz von vorn anfangen, da dachte ich auch, daß wäre doch wirklich großartig, wenn das klappen würde: Ich erfinde die Musik ganz persönlich nochmal von vorne. Aber irgendwann merkt man: das ist eigentlich eine ganz schön pubertäre Idee, denn es ist ja schon technisch unmöglich – man kann nicht, als Einzelner natürlich nicht, die Musik neu erfinden. Auch eine Epoche kann das nicht, alles was man macht hängt an ganz vielen Fäden mit der Tradition immer schon zusammen, und gar nicht nur mit der Tradition, die einem bewußt ist, Es ist eben schon sehr viel Musik gemacht worden auf dieser Welt, auch in anderen Kulturen, und es wäre wirklich sehr merkwürdig, wenn da plötzlich etwas ganz Neues auftauchen würde. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich. Dann fängt man aber doch an und sagt, ich will aber trotzdem etwas Neues machen, und jetzt auch nicht nur einfach reproduzieren, und dann kommt man eben dazu, daß man diesen ganzen Ballast erstmal wegwirft, auch anfängt auf physische Impulse, zu hören: was will mein Ohr, was will meine Hand, was für die Musik ja auch interessant ist. Aber wir haben wir ja diese wunderschöne Notenschrift, die habe ich auch immer weiter verwendet. Das allein ist schon Transformation, das heißt, wie ich bin, was ich fühle, was ich höre, wird durch die Notenschrift schon in gewisser Weise kanalisiert, wenn ich etwas aufschreibe. Das hat auch praktische Gründe, weil die Interpreten natürlich das ja auch irgendwie lesen können müssen, und das können sie nicht, wenn ich mit einer ganz neuen Notationsweise komme. Und dann ist natürlich schon in der Schrift allein sehr viel Tradition drin, was ich aber angenehm finde. Man möchte ja auch ein bißchen getragen werden, viele Komponisten von Neuer Musik leider unter einer großen Einsamkeit, weil niemand Neue Musik mag, sie klingt so schräg usw. und aus dem Ganzen möchte ich mich eigentlich ganz gerne heraushalten: Das heißt, ich bin nett zu der Tradition, wenn sie auch nett zu mir ist, und so kommen wir, so glaube ich, ganz gut klar.
NB
Das ist doch ein schönes Schlußwort – und wir freuen uns jetzt auf die Uraufführung des 6. Streichquartetts von Albert Breier.